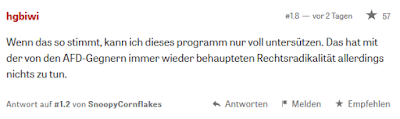"Die bemerkenswerte Ahnungslosigkeit über einzelne Personen des islamistischen Spektrums ist nach meinem Eindruck kein spezifisch deutsches oder gar Berliner Problem, sondern hat sich bei vielen Fällen islamistischer Straftaten der letzten Monate auch im Ausland immer wieder gezeigt.
Das hängt offensichtlich zusammen mit dem sehr komplexen und vielschichtigen Phänomen "Islamismus" und seinen vielen Facetten sowie mit der Tatsache, dass es trotz zahlreicher wissenschaftlicher Forschungsprojekte bisher nicht gelungen ist, taugliche Merkmale radikalisierungsanfälliger Personen zu definieren."
Die Sätze stammen aus dem
Abschlussbericht des Sonderbeauftragten Bruno Jost, der das Behördenhandeln nach dem Anschlag vom 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidtplatz untersuchte. Neben dem Wort "Behördenversagen", das recht schnell medial geprägt wurde - Jost nennt zahlreiche Beispiele für unzureichende Auswertungen, fehlende Zusammenführungen von Daten und mangelnder Koordination - und der auch heute noch aktuellen
Diskussion, ob der Staat angemessen auf die Bedürfnisse der Opfer und deren Angehörigen reagierte, kommt hier ein weiterer Punkt zum Ausdruck: mangelndes Wissen bzw. blinde Flecke bei den Behörden, aber auch in der Politik (und der Öffentlichkeit). Denn im Zusammenhang mit der Frage, ob und wie der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hätte verhindert werden können, geht es ja auch darum, ob und wie Menschen davon abgehalten werden können radikal zu werden und solche Anschläge zu begehen.
Der Bericht zeigt damit (ohne diese Themen direkt zu addressieren) die Bedeutung der Prävention und des Verständnisses von Radikalisierungsprozessen. Genau dieser Frage widmete sich dann auch Anfang dieser Woche eine Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel
"Grenzenloser Salafismus - Grenzenlose Prävention", die sich mit dem Thema aus einer europäischen Sicht auseinandersetzte. Denn:
Die meisten Anschläge zeigen dieses Merkmal, also die Bedeutungslosigkeit von Grenzen für das Handeln radikal salafistischer Akteure. Wer nun aber reflexhaft die Forderung nach geschlossenen Grenzen erhebt, sollte sich bewusst sein, dass Terrorismus ein höchst fluides und dynamisches Phänomen ist. In den vergangenen 25 Jahren haben sich die Strategien mehrmals und fundamental verändert. In autokratischen und totalitären Staaten mögen Anschläge seltener sein, ausschließen lassen sie sich nicht. Eine einfache Lösungstrategie zu propagieren, helfe kaum weiter, so auch die Leiterin der Fachabteilung der bpb, Dr. Caroline Hornstein Tomic:
Einer der führenden Forscher im Bereich islamistischer Terrorismus und militanter Salafismus, Gilles Kepel, wies in seinem Vortrag auf das Austauschverhältnis von Sicherheit und Freiheit hin, nicht ohne deutlich vor den Gefahren durch salafistische Akteure zu warnen:
Soziale Faktoren von großer Bedeutung
Ein Vergleich dschihadistischer Salafisten mit Terroristen der 19070er Jahre in Deutschland und Italien sei zwar zulässig, da sich die Strategien ähnelten. Jedoch greife er zu kurz und schaffe nicht das nötige Verständnis, um aktuelle Phänomen zu bekämpfen. Denn die Logik der Akteure sei eine gänzlich andere. Dies verändere z.B. die Rekrutierungskanäle. Die Ideologie und soziale Faktoren gingen dabei Hand in Hand, so Kepel.
Er spricht von "global victimization" mit der es eine direkte Bezugnahme auf soziale Deprivation (also eine Ausgrenzung, die unterschiedlichste Ursachen haben kann) gebe. Dies sei die neue Strategie des Dschihad bzw. dessen Protagonisten in der dritten Phase gewesen, um die globale Ausbreitung zu unterstützen. Hieraus ergeben sich wichtige Hinweise auf die Bedeutung der sozialen Dimension, um Terrorismus zu bekämpfen bzw. Radikalisierung zu verhindern.
Strategiewechsel zeigen Wandlungsfähigkeit
Diese dritte Phase des salafistischen Dschihad, sieht Kepel auch durch einen Strategiewechsel geprägt: Nicht mehr "top-down", sondern "bottom-up". Also keine zentrale Instanz mehr, die logistisch steuert, sondern eine, welche "Graswurzelbewegungen" ideologisch fördert. Man könnte auch sagen, dass Netzwerke im Zusammenhang mit der Radikalisierung ihre hohe Bedeutung behalten, für die eigentliche Planung und Umsetzung eines Anschlags aber nur noch eine untergeordnete Rolle spielen bzw. ihr Einfluss sinkt. Dies lässt sich aus der "wachsenden Banalität" (Jost) der Attacken erklären. Platt gesagt, es genügt der Wille und ein Küchenmesser. Oder eben ein LKW.
Kepel wies in seinem Vortrag auch auf die gestiegene Akzeptanz unter Muslimen hin. Dies sei keineswegs selbstverständlich und Ergebnis einer längeren Prozesses. Erste Dschihadisten, z.B. in Algerien, wurden noch als "Fremde" und "Störenfriede" betrachtet und erhielten keine Unterstützung durch die Bevölkerung. Dies änderte sich erst nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Zum einen wurde die Verletzlichkeit des Westens deutlich, zum anderen befeuerte die militärische Reaktion die "Beliebtheit" des Dschihad, bzw. führte den Menschen vor Ort die scheinbare Legitimität des bewaffneten Kampfes vor Augen. So dürfe der Irakkrieg nicht unterschätzt werden. Er prägte den dschihadistischen Salafismus
als Ideologie. Deutschland wurde dabei anfangs verschont. Dies ergab sich nicht nur aus der Nichtteilnahme am Krieg, sondern hatte auch soziale
Gründe. Eine geringere Arbeitslosigkeit und die Dominanz von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, die vor allem durch ihre nationale Identität und weniger religiös geprägt waren, spielten dabei eine wichtige Rolle.
Auch hieraus ergeben sich wieder Lehren für die Prävention und Deradikalisierung. Harte Gegenschläge oder gar Präventivmaßnahmen unter Inkaufnahme
hoher ziviler Opferzahlen spielen Terroristen in die Hände. Auch eine monolithische Sichtweise des Islams und die Klassifizierung als naturgemäß stark politisierte und gewaltbereite Religion lassen sich nicht halten und verstellen den Blick auf tieferliegendere Ursachen.
Das reine Reiz-Reaktions-Schema ist sicherlich zu vereinfachend. Denn der Salafismus wurde schon in den 1980er-/1990er-Jahren zunehmend politisch und radikal. Ausgangspunkt des Dschihad waren Afghanistan bzw. Pakistan. Zunächst handelte es sich jedoch um einen "defensiven Dschihad", der allerdings weitreichende Konsequenzen hatte. Denn Gewalt wurde zunehmend als notwendiges und legitimes Mittel betrachtet. Diese Genese der Militanz und Radikalität führt heute dazu, dass das Narrativ der Gewaltanwendung in radikal salafistischen Kreisen nicht mehr hinterfragt wird. Doch dies war eben nicht immer so.
Anerkennen von Multikausalität als Grundbedingung der Präventionsarbeit
Kepel machte aber auch deutlich, dass spezifisch europäische Faktoren zur heutigen Gestalt des radikalen Salafismus beitrugen. Kinder von Immigranten grenzten sich formal mit dem Erlernen der Sprache der neuen Heimat ab und wurden bereits im Rahmen der Schulbildung anders sozialisiert als deren Eltern. Dies löste laut Kepel eine Art Gegenbewegung aus, z.B. in Form einer religiösen Bildung, die zur Abgrenzung beitrug. Dies wurde allerdings zunächst als völlig unproblematisch betrachtet. Doch vor allem soziale Faktoren trugen zu einer Isolation bestimmter Gruppen bei. Historisch gesehen veränderte sich die Situation zudem Anfang der 1990er als Saudi-Arabien direkt in Europa Einfluss nahm. Der Salafismus wurde mit Hilfe saudischer Mittel als strikte Auslegung des Islam politisch propagiert. War dies anfangs noch analog und schleppend, kamen die großen Veränderungen mit der digitaler Vernetzung.
An diesem Punkt stehen wir heute. Das Internet spielt eine zentrale Rolle für die Radikalisierung von (vor allem) jungen Menschen. Bislang reagieren die europäischen Staaten überwiegend (betrachtet man die eingesetzten finanziellen Mittel) mit sicherheitspolitischen Instrumenten. Auch Gilles Kepel hob in seinem Vortrag deren Notwendigkeit hervor. Doch gehe es nicht immer nur um "Mehr", sondern auch um eine andere Qualität. Er sieht die Zentralisierung der Sicherheitsbehörden als entscheidenden Faktor an. Doch schränkten er und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Wirksamkeit der Sicherheitsarchitektur auch deutlich ein. Die Formel ist dabei einfach: Ohne ein tiefgehendes Verständnis für die Ideologie keine wirksame Terrorbekämpfung. Prävention müsse dabei nicht nur individuelle psychologische Faktoren einbeziehen, sondern fragen: Was werden künftige Ziele und Strategien sein?
Denn die militärische Niederlage des IS und die bereits erfolgte Restrukturierung der Sicherheitsbehörden hat die Situation verändert. "Bottom-up terrorism" zeigt nun seine "Nachteile", nämlich einen Mangel an Visionen und Strategie. Dieses Vakuum wird sicherlich bald gefüllt werden, die vierte Phase des Dschihad beginnen.
Der Vortrag Kepels öffnete damit eine Tagung, die sich von der individuellen Mikroebene (Was brachte ihn/sie dazu einen Anschlag zu begehen?), über die gesellschaftliche Mesoebene (Welche sozialen Hintergründe hatten die Täter/Täterinnen?) bis hin zur Makroebene mit den Fragen von Krieg und Frieden (Welche Ressourcen besitzen Terrorgruppen? Welche globalen Strukturen begünstigen terroristische Aktionen?) mit zahlreichen Facetten des Phänomens beschäftigte.
Nicht immer lassen sich dabei Muster finden, Widersprüche müssen ausgehalten und in die Analyse miteinbezogen werden. Zum Beispiel auf der individuellen Ebene: Die "postmoderne" Dschihadistenrolle baut solche Widersprüche, wie den Handel mit Drogen oder den Genuss von Alkohol, integrativ mit ein. Sie sind kein Widerspruch, sondern Wesensmerkmal. Vereinfachungen und Generalisierungen sind also nicht angebracht: "Ich habe Hunderte von Leuten mit einer solchen Biographie gesehen, die sich nicht radikalisiert haben", brachte es ein Teilnehmer auf den Punkt.
Die Öffentlichkeit, die Medien und die Behörden täten also gut daran sich
eingehender mit der Thematik zu beschäftigen. Dies verhindert, dass Personengruppen kollektiv unter Verdacht gestellt werden und eine effektive und im rechtstaatlichen Rahmen agierende Terrorismusbekämpufung möglich bleibt.
Anmerkung: Der Autor ist Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Text ist eine persönliche Wahrnehmung der beschriebenen Konferenz und stellt keine offizielle Meinungsäußerung der bpb dar.